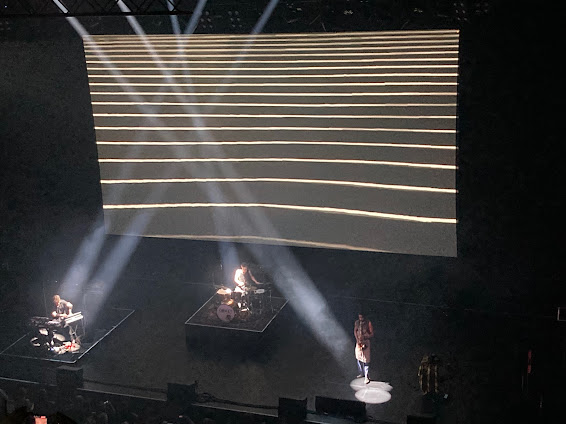Jazz als Pop denken
Florian Egli, Bandleader und Saxofonist, gibt Einblicke in die Ideenwelt von Weird Beard
Das kurze, prägnante Synthesizer-Riff zum Einstieg hätte in den 1980er Jahren Gruppen wie Depeche Mode oder The Human League gut zu Gesicht gestanden. Das Synthi-Pop-Ostinato bildet den Auftakt zum neuen Album „Vertigo“ von Weird Beard, einer Schweizer Gruppe, die eigentlich aus dem Jazz kommt. Allerdings ist Weird Beard kein konventionelles Jazzensemble, sondern mischt eine Vielzahl von Stilen zu einer höchst individuellen Ausdrucksweise. Neben Elementen aus Pop, Rock, Disco, Dub und Electronica findet sich Einflüssen aus Cool- und Electric Jazz. Das macht Weird Beard zu Protagonisten einer aktuellen Strömung, die im Jazz wurzelt, aber gleichzeitig darüber hinausweist. Post-Jazz wäre vielleicht der passende Stilbegriff.
„Vertigo“ ist das vierte Album von Weird Beard. Wie ist die Gruppe entstanden und wie hat sie sich entwickelt?
Florian Egli: Die Anfänge von Weird Beard reichen bis in meine Studienzeit an der Musikhochschule in Zürich zurück. Ich habe damals – 2007 und 2008 – sehr intensiv mit dem Bassgitarristen Valentin Dietrich im Duo gespielt. Wie probten viel, haben diskutiert und philosophiert und sind dadurch gute Freunde geworden. Dieses Duo war der Kern, aus dem Weird Beard hervorging. Rico Baumann kam als Schlagzeuger hinzu und für kurze Zeit der Gitarrist Urs Vögeli, dessen Platz dann von Dave Gisler eingenommen wurde. Nach ein paar Jahren verließ Valentin Dietrich die Band und wurde von der Bassistin Martina Berther ersetzt. Berther hat einen starken experimentellen und popmäßigen Background und brachte viele frische Ideen ein. Für „Vertigo“ haben wir zusätzlich noch den Synthesizerspieler Luzius Schuler ins Boot geholt. Uns war wichtig, nicht stehen zu bleiben, sondern Neues zu wagen. Die Band muß in Bewegung bleiben, sich verändern, neue Impulse aufnehmen, sonst droht Routine und Stillstand.
Was war zu Beginn die musikalische Vision?
FE: Wir hatte einigermaßen genaue Vorstellungen, in welche Richtung wir gehen wollten. Ich war damals sehr von der Musik der Band Alas No Axis des amerikanischen Schlagzeugers Jim Black angetan, die Lyrisches mit Elektronik und Hardcore-Jazz verband, und wollte einen ähnlichen Stil erkunden. Die anderen hatte andere Einflüsse, die aber alle auf eine Mischung von Pop, Rock und Jazz hinausliefen.
Was fasziniert einen Jazzmusiker an Rock und Pop?
FE: Was ich am Jazz mag, ist der Augenblick, also das Spontane und das Vergängliche, das sich in jeder Improvisation manifestiert, die ja immer anders ist. Was mich dagegen an Pop interessiert, ist die Dimension der Ewigkeit. Im Pop wird das Tonstudio als eigenständiges Medium begriffen, in welchem Musik für die Nachwelt produziert wird. Die Schallplatte ist ein Statement, von dem man hofft, dass es lange Bestand hat. Im Jazz war es bis vor noch nicht allzu langer Zeit üblich, ins Studio zu gehen, um den „Live“-Auftritt einer Band unter optimalen Bedingungen aufzunehmen. Das war das Ziel einer Schallplattenaufnahme. Dagegen begreifen wir die Plattenproduktion wie im Pop als etwas grundsätzlich Anderes als den „Live“-Auftritt. Das Studio bietet ganz andere Möglichkeiten, die es auszuschöpfen gilt.
Wie arbeitet Weird Beard im Studio?
FE: Das Material wird „live“ eingespielt. Also jedes Stück wird in einem Bogen aufgenommen, um die Energie, die Spannung, die Dynamik, die Stimmung und Atmosphäre einzufangen. Danach werden – falls erforderlich – Overdubs gemacht. Beim Stück „Cinema“ hat unser Schlagzeuger Rico Baumann z.B. noch eine zweite Drumspur draufgemacht, und beim Titel „Vertigo“ hat Luzius Schuler mit dem Synthesizer im Nachhinein noch eine Sternenhimmelmelodie hinzugefügt.
Wie vertraut war euch das musikalische Material zu Beginn der Aufnahmen?
FE: Es war ziemlich frisch. Die generelle Idee war, dass die Stücke so einfach sein sollten, dass sie ohne intensive Proben funktionieren. Wir wollten keine Stücke spielen, die in eine bestimmte Form gepresst sind, wo der Ablauf vorgegeben ist oder ein dynamisches Schema. Die Kompositionen sollten so angelegt sein, dass sie offen sind und viele Möglichkeiten bieten.
Das Album wurde in Frankreich aufgenommen. Warum?
FE: Wir arbeiteten lange mit dem irischen Toningenieur und Produzenten David Odlum zusammen, der damals in der Bretagne das Blackbox-Studio betrieb, seither aber wieder nach Irland zurückgekehrt ist. „Vertigo“ ist das dritte Album, dass Weird Beard mit Odlum produziert hat, der bei den Aufnahmen zu einem vollwertigen Mitglied der Band wurde.
Florian Egli (Promo)
Wie lief die Arbeit im Studio konkret ab?
FE: Odlum ließ uns zuerst ein Stück spielen, hörte es sich genau an und fing dann bereits an, das Studio-Equipment einzurichten. Er entwickelte Ideen für den Klang der jeweiligen Instrumente, vor allem was den Baß und das Schlagzeug betrifft. Soll es härter klingen oder weicher? Fetter oder schlanker? Solche Fragen wurden diskutiert. Das hat Einfluß auf die Mikrofonierung, also wie die Instrumente abgenommen werden und wo man Mikrofone platziert. Wie nah dran bzw. wie weit weg? In dieser ersten Phase geht es darum, den Sound bereits richtig einzufangen. Das braucht Zeit. Odlum schickte uns weg und meinte: “Kommt in einer Stunde wieder.“ Dann spielten wir das betreffende Stück erneut, und er werkelte weiter am Sound. Er schickte uns möglicherweise ein zweites Mal fort, um weiter an den Einstellungen zu basteln. Wir hörten uns das Ergebnis der Aufnahme an und diskutierten, wie der Sound noch verbessert werden könnte. Entspricht er unseren Vorstellungen? Meistens waren wir einer Meinung. David Odlum verstand, welcher Sound uns vorschwebte und versuchte diesem Klangbild so nahe wie möglich zu kommen.
Wenn die Aufnahmen im Kasten sind, ist die Studiotätigkeit abgeschlossen oder beginnt dann die Nachbearbeitung?
FE: Die sogenannte „Post-Production“ ist absolut wesentlich. Im Dialog mit der Band träufelte David Odlum noch einmal seine Klangkunst über die Aufnahmen. Wie dumpf soll die Baßtrommel klingen? Wieviel Nachhall gebe ich einem Randschlag der Snare? Wieviel Baß braucht die Aufnahme?
Weird Beard stellt viele Gepflogenheiten des Jazz auf den Kopf. Die übliche Unterteilung von Führungsstimme und Rhythmusgruppe ist aufgehoben. Auch gibt es keine Solos im herkömmlichen Sinne mehr, eher wird mit Klängen über einem festen Rhythmusfundament improvisiert. Was ist die Konzeption?
FE: Es geht nicht mehr um Vorder- und Hintergrund, nicht mehr um Solisten und Begleiter, sondern was alleine zählt, ist der Gesamtsound: Das einheitliche Klangbild der Gruppe. Selbst meine Saxofonstimme ist in den Gruppenklang eingebettet, fungiert nur noch bedingt als Melodiestimme. Ich spiele zurückgenommen und sehr reduziert, sozusagen mit angezogener Handbremse, lege größten Wert auf den Klang und die Platzierung jedes einzelnen Tons. Auf diese Weise Saxophon zu spielen, ist ein Kraftakt der Zurückhaltung, weil das Instrument ja eigentlich für das Gegenteil gemacht ist, nämlich virtuos und schnell viele Töne zu spielen. Bei den Aufnahmen für „Vertigo“ hatte ich das Gefühl, an einem Punkt angelangt zu sein, wo ich das Saxofon nur noch als eine Art Soundpad benutze.
Florian Egli Weird Beard: Meditation (Youtube)
Die meisten Stücke von „Vertigo“ sind in gemächlichem Tempo gehalten. Kann diese Entschleunigung als Kontrast zur Hektik der Gegenwart verstanden werden? Warum dehnt ihr die Zeit?
FE: Das Langsame war von Anfang an ein Thema bei Weird Beard, auch wenn es zu Beginn noch nicht so deutlich durchdrang. Früher glaubte ich, die langsamen Tempi seien eine Art Konterbewegung zur Hast des Lebens von heute. Das mag auch unterbewußt der Fall sein. Doch inzwischen bin ich der Ansicht, dass es vor allem eine Mentalitätssache ist. Wir mögen einfach langsame Musik. Daraus erwächst ein Problem: Es ist nicht einfach, beim Musizieren genügend Geduld aufzubringen, um das Momentum der Kreativität abzuwarten. Doch wenn man den richtigen Augenblick erwischt, geschieht etwas Wunderbares: Dann entsteht die Musik wie von selbst, sie geschieht einfach und macht Sinn. Für uns funktioniert das bei langsamen Tempi besser als bei schnellen.
Das neue Album besteht aus sieben Titeln, vier Eigenkompositionen und drei Covers. Wie kam die Auswahl zustande?
FE: Meine ursprüngliche Vision war, dass wir nur drei Stücke aufnehmen, die so gespielt werden sollten, als könnten sie ewig dauern. Am Jazz stört mich, dass er normalerweise auf einen Höhepunkt aus ist. Das wollte ich vermeiden. Ein Stück sollte theoretisch zwei Stunden fließen können und immer noch interessant sein, obwohl dynamisch nicht viel passiert. Es geht darum, in die Weite zu schauen und nicht den schnelle Klimax zu suchen. Wir haben dann festgestellt, dass meine Kompositionen „Meditation“, „Eternity“, „Phoenix“ und „Vertigo“ dafür nicht ausreichten. Sie trugen sieben oder acht Minuten und kamen dann zu einem natürlichen Ende. Wir haben das akzeptiert, wollten die Ursprungsidee nicht dogmatisch erzwingen und haben deshalb noch drei Fremdkompositionen dazugenommen: den Jazzstandard „Lush Live“ von Billy Strayhorn, den Titel „Adia“ der rätoromanischen Sängerin Ursina und „Cinema“, ein Stück der Indieband East Sister aus Basel. Ich hatte diesen Titel vor ein paar Jahren durch Zufall auf einer Party gehört und war verblüfft, wie genau er meine Vorstellungen von Musik traf.
Die Musik von „Vertigo“ springt einem nicht ins Gedicht. Sie will keine Räume beherrschen, ist eher zurückgenommen. Zudem strahlt sie eine gewisse Gelassenheit aus, wirkt manchmal fast beiläufig )
FE: Genau – und trotzdem passiert immer etwas! Man kann unsere Musik konzentriert hören, aber sie stört auch nicht, wenn sie nur im Hintergrund läuft – und trotzdem ist es keine Backgroundmusik. „Vertigo“ ist der Versuch, dieses Paradox zu lösen. Die Musik drängt sich nicht in den Vordergrund, sondern will so subtil sein, dass man auch bei mehrfachem Zuhören immer noch Neues entdecken kann.
FLORIAN EGLI WEIRD BEARD: VERTIGO (INTUITION)